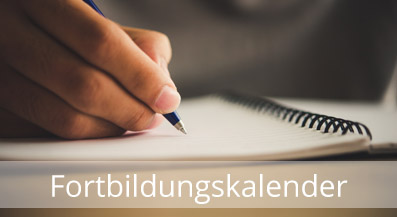Julius Mezger: Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre – rezensiert von Stefan Reis (überarbeitete Version)
Julius Mezger: Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre – rezensiert von Stefan Reis (überarbeitete Version)
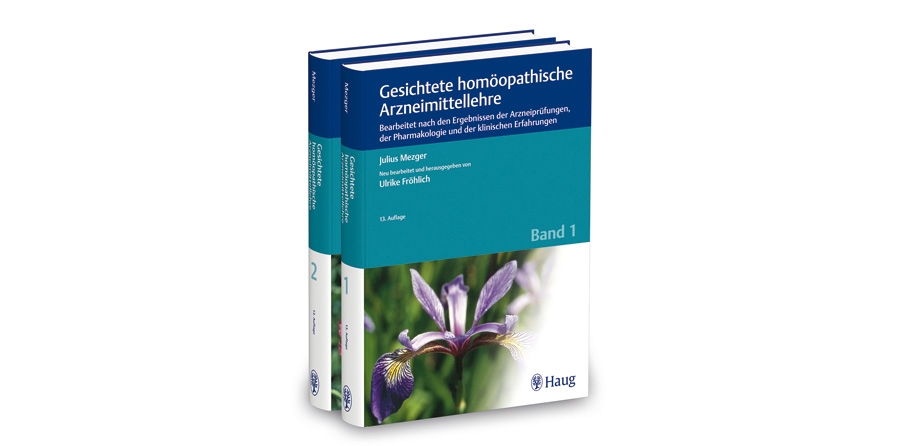 Julius Mezger: Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre – rezensiert von Stefan Reis
Thieme Verlag
Julius Mezger: Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre – rezensiert von Stefan Reis
Thieme Verlag
Der „Mezger“ galt lange Zeit als eine Standard-Arzneimittellehre in der Homöopathie. Julius Mezger zählte zu den einflussreichen Homöopathen der Nachkriegszeit und ist bekannt für seine exakt durchgeführten Arzneimittelprüfungen. Nun wurde sein Werk „Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre“ neu bearbeitet und herausgegeben. Stefan Reis hat es für Sie rezensiert.
Eigentlich ist das Dasein eines Rezensenten sehr angenehm: Man wird kostenlos mit den zu besprechenden Büchern versorgt, die man zum Lohn in der Regel behalten darf. Mit der Zeit kommt man so zu einer stattlichen Bibliothek. Das alles ist solange ganz wunderbar, wie man aus dem Jubel oder dem Geschimpfe über eine Neuerscheinung nicht mehr herauskommt. Saurer verdient ist der Lohn in den Fällen, in denen es damit nicht getan ist. So geht es mir mit der Neuauflage des „guten alten Mezger“.
Julius Mezger: Der „letzte große Lehrmeister der Homöopathie“
Bevor ich zur Rezension komme, sind vielleicht ein paar Informationen zu Autor und Werk angebracht, weil der Name Julius Mezger heute womöglich nicht allen Lesern mehr geläufig ist.Mezger (1891-1976) zählte zu den einflussreichen Homöopathen der Nachkriegszeit, die man nicht gerade als Blütezeit der Homöopathie bezeichnen kann. Er war am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart tätig und galt laut Schroers (Lexikon deutschsprachiger Homöopathen) gar „als der letzte große Lehrmeister der Homöopathie“. Vor allem seine sehr exakt durchgeführten Arzneimittelprüfungen verdienen bis heute allergrößten Respekt. Die „Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre“ erschien erstmals 1950 und in weiteren zwei Auflagen noch zu Lebzeiten ihres Verfassers. Damals war das Angebot an homöopathischen Arzneimittellehren übrigens dürftig und mit der heute verfügbaren Palette nicht vergleichbar. Der „Mezger“ wurde also rasch zu einem Erfolgstitel. Die vorläufig letzte, zwölfte Auflage war zuletzt im Jahr 2007 unverändert gedruckt worden.
Klinische Symptome waren gekennzeichnet
Als Wesensmerkmal des „Mezger“ kann man die Zweiteilung der Arzneidarstellung bezeichnen. Nach einer mehr oder weniger umfangreichen Einleitung, in der Mezger über die Pharmakologie und gegebenenfalls die homöopathische Prüfung und klinische Verwendung des jeweiligen Arzneistoffs informierte, folgte eine nach Leit- und weiteren, im Kopf-Fuß-Schema sortierten Symptomen angeordnete Liste. Zuletzt brachte er mitunter noch ein paar kasuistische Beispiele. Was mich immer sehr für "den Mezger" einnahm, waren vor allem zwei Dinge: zum einen die Tatsache, dass er sich bemüht hatte, Prüfungs- von klinischen (d.h. fallbasierten) Symptomen erkennbar zu unterscheiden, indem er letzteren ein ʘ voranstellte. Diese Kennzeichnung wurde bereits von Hahnemann angemahnt, von GHG Jahr systematisch umgesetzt, danach aber mehr und mehr vernachlässigt, was heute zu dem Umstand führt, dass in gängigen Arzneimittellehren die Herkunft der Symptome nicht nachzuvollziehen ist. Zum anderen beeindruckte das Werk mit einigen Arzneimitteln, die von Julius Mezger geprüft und in den homöopathischen Arzneischatz eingeführt worden waren, wie etwa: Aristolochia clematitis, Hedera helix, Mandragora officinalis sowie verschiedene Magnesium-Salze.Zu der durchaus berechtigten Diskussion, warum oder inwiefern „der Mezger“ den Hahnemannianern als zu wenig genuin und den Kentianern als zu wenig fortschrittlich gilt, soll die vorliegende Rezension keinen Beitrag leisten. Es geht im Folgenden allein um die Qualität der Neubearbeitung.
Neuauflage war Mammutprojekt
Nachdem der "Mezger" also zuletzt 2007 nachgedruckt worden war, schien nun die Zeit reif für eine Neuauflage. Dafür hat sich die homöopathische Ärztin Ulrike Fröhlich der aufwändigen Aufgabe angenommen, Mezgers Werk - wie sie schreibt – „mit Sachverstand und in seinem Sinn“ (S.8) zu überarbeiten.Auf der Homepage der Hahnemann-Gesellschaft (http://www.hahnemann-gesellschaft.de/projekte/) kann nachgelesen werden, mit welchen Anstrengungen dieses neun Jahre währende Mammutprojekt verbunden war. Vor der Bereitschaft, sich diesen Strapazen und Kosten zu unterziehen, kann man nur den Hut ziehen.
Trotz des Respekts, den man der Bearbeiterin hierfür schuldet, ist es Aufgabe einer Rezension, das Ergebnis kritisch zu beurteilen.
Keine Kennzeichnung der Änderungen
Eine allgemeine Kritik sei gleich vorab geäußert: Die von der Bearbeiterin Ulrike Fröhlich vorgenommenen Änderungen sind nicht kenntlich gemacht worden, so dass künftige Anwender des "Mezger" die Autorschaft einzelner Passagen nicht zweifelsfrei erkennen können. Kaum jemand wird sich eine ältere Ausgabe zulegen, um das umständlich nachvollziehen zu können. Hier hätte ich mir gewünscht, dass die Änderungen in einem Anhang, oder auch als Download für Interessierte zur Verfügung gestellt worden wären.Vorausschicken möchte ich zudem noch, dass es mir bei der Erstellung der Rezension nur möglich war, Stichproben abzugleichen.
Zum Inhalt
Frau Fröhlich schreibt einleitend, dass „es überraschte, wie der Inhalt in den Bereichen Pharmakologie und Toxikologie fast völlig erneuert werden musste, während ab dem Gliederungsbereich homöopathische Anwendungen und Arzneimittelbild lediglich geringe Änderungen erforderlich [!] waren.“ (S. 8)A) Beschreibung der Arzneistoffe
Betrachtet man also zunächst diese einleitenden Abschnitte über den jeweiligen Arzneistoff, fällt tatsächlich auf, dass diese fast völlig neu verfasst wurden.A 1) Passagen entfallen
Fröhlich hat die Angaben nicht nur aktualisiert, sondern auch vereinheitlicht bzw. einem vorgegebenen Schema angepasst, was zum Beispiel bei Ferrum metallicum dazu führt, dass durch die Neubearbeitung ganze vier Druckseiten des Originals einfach wegfallen. Diese befassten sich mit der „Pathogenese der Eisenmangelerkrankung“ und sind womöglich tatsächlich entbehrlich, aber andererseits erscheint dies doch als starker Eingriff ins Original. Die von Mezger noch erwähnte Bryonia-Nachprüfung von Martini fehlt in der vorliegenden Neuausgabe - nun gut, sie war auch "ohne Erfolg" geblieben, aber was heißt das schon?A 2) Sprachliche Überarbeitung
Durch den ganzen Textkörper (also inklusive die Symptomenlisten) zieht sich auch eine sprachliche Überarbeitung. Weshalb nun "Kopfschmerzen" gegen "Zephalgien" oder "Harnverhaltung" gegen "Ischurie" ausgetauscht werden mussten, erschließt sich mir jedoch nicht und erscheint etwas übereifrig. Wenn Mezger einst schrieb, dass "der Schlaf lebhaft gestört ist", liest man jetzt, "dass eine Insomnie besteht." (Bd.1, S. 251) Bei Angustura findet man im Original die Indikationen "Rheumatische Steifigkeit, Spannungs- und Krampfzustände der Muskeln" (Bd.1, S. 150), die in der neuen Version zu "Distorsionen [!], Arthritis rheumatisch, Myalgien" (Bd.1, S. 208) wurden.Ob man das als notwendige Verbesserung oder unnötigen Eingriff in die originale Sprache versteht, ist wohl Geschmackssache - meinen Geschmack trifft es allerdings nicht.
Diese Einwände ändern aber nichts daran, dass die sinnvolle Neuformulierung und -ordnung dieser einleitenden Abschnitte als überwiegend gelungen zu bezeichnen ist.
B) Auflistung der Symptome
Auch in den zweiten Teil der Arzneidarstellung - die Auflistung der Symptome - sind Änderungen eingeflossen, die nach meinem Dafürhalten kritischer zu beurteilen sind.B 1) Umstellung des Ordnungsschemas
Mezger hatte für die Darstellung der Symptome eine Anordnung gewählt, die im Wesentlichen aus anderen Arzneimittellehren geläufig ist. Zunächst wurden die Leitsymptome der Arznei aufgelistet. Dann folgten weitere Symptome in einem Kopf-Fuß-Schema, das jedoch ein wenig abwich von der üblichen Sortierung in der Materia medica.So hatte Mezger den Abschnitt "Allgemeines" im Anschluss an die "Leitsymptome" an den Anfang der weiteren Beschreibung gestellt. In der Neubearbeitung (nach "dem in der Homöopathie üblichen Kopf-Fuß-Schema", S. 8) findet sich dieser Abschnitt jetzt am Ende der Darstellung. Dieser Eingriff in das Ursprungswerk geht meines Erachtens zu weit.
Am Beispiel Calcium carbonicum sei in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass sich das unter "Allgemeines" bei Mezger Aufgelistete in der Fröhlich-Ausgabe nun nicht unter dieser Überschrift findet, sondern (S. 411) unter den "Leitsymptomen" gelistet ist – sicher ein Versehen, aber eben auch ein Fehler.
Umgestellt wurde grundsätzlich auch der Abschnitt "Atmungsorgane", der im Original dem "Gesicht" folgte und vor "Herz und Kreislauf" erwähnt wurde, so dass bei Mezger die Atemwege sozusagen bei der Nase anfingen. Der in den meisten Arzneimittellehren üblichen Anordnung folgend, hat Fröhlich die Nasensymptome an der angestammten Stelle belassen, die Schnupfen-, Atmungs- und Hustensymptome jedoch in ein eigenes Kapitel verfrachtet, das nun den Genitalien folgt. So kommt es bei Nux vomica dazu, dass sich das Symptom "Scharriger, rauher und trockener Husten mit brennenden Schmerzen im Rachen und im Kehlkopf" nun aber nicht unter "Husten", sondern unter "Innerer Hals" findet. Das ist sicher nicht falsch, aber doch mindestens unglücklich.
Dem "Schlaf" wurde dasselbe Schicksal zuteil. Während er im Original dem "Gemüt" folgte (was womöglich auf den Stellenwert der Schlafsymptome deutete, den Mezger ihnen zumaß), findet man das Kapitel nun am Ende des Kopf-Fuß-Schemas.
Womöglich ist das Verschieben von Textblöcken der Grund für folgendes Missgeschick: Im Original wurde der ersten Kasuistik zu Bryonia alba eine Liste mit Temperaturmessungen beigefügt, die sich über einen Zeitraum von 14 Tagen erstreckte. In der Neubearbeitung (S. 387) fehlen davon die letzten drei Tage.
Noch ein letztes Beispiel: Mezger besprach in seinem Werk die bekannteren Arsen-Präparate Arsenicum album und Arsenicum jodatum, darauf folgend dann "weitere Arsenpräparate" und danach die "Vergleichsmittel", die sich aber, wie man leicht erkennen konnte, wieder auf die "Haupt-Arznei" Arsenicum album bezogen. Auch bei den abschließenden Kasuistiken war das Heilmittel jeweils das Arsenik. Diese im Original etwas unübersichtliche Anordnung ist in der Neuauflage nicht nur nicht optimiert worden - was leicht machbar gewesen wäre - im Gegenteil: Die Vergleichsmittel sind nun als allein zu Arsenicum iodatum gehörig zu identifizieren (S. 289f.), die Ars.-Kasuistiken sind ebenfalls unter Ars-i. zu finden und die von Mezger noch beigesteuerte Liste von "weiteren Arsenpräparaten" mit zahlreichen klinischen Indikationen für die einzelnen Arzneien ist komplett verschwunden!
Man mag diese Umstellungen als Ansichtssache und die dabei aufgekommenen Abweichungen als Flüchtigkeitsfehler abhaken können. Andererseits wäre zu berücksichtigen, dass Mezger mit seiner Sortierung womöglich eine Rangordnung der Symptome oder Organe abbilden wollte. Außerdem zeigen schon die wenigen Stichproben, dass mehr Sorgfalt hier gut getan hätte.
B 2) Änderung der Schrifttypen bereitet Probleme
Im Zuge der Bearbeitung wurden auch die Schrifttypen verändert. Hierbei ist leider ein schwerwiegender Fehler unterlaufen. Im Original gab es, wie bereits erwähnt, zur Unterscheidung von Prüf- und klinischen Symptomen das Zeichen ʘ. Hiermit wurde also lediglich die Herkunft eines Symptoms angegeben, nicht aber dessen Wert. Für diesen gab es bei Mezger zwei Kriterien: Zum einen wurden die "Leitsymptome" in einem eigenen Abschnitt im Kursivdruck wiedergegeben. Darüber hinaus erschienen einzelne Symptome im weiteren Verlauf der Darstellung im Sperrdruck, was ihnen eine größere Bedeutung verlieh. In der Neuausgabe wird nun der Sperrdruck zum Fettdruck, darüber hinaus aber werden sämtliche klinische Symptome, unabhängig von einem ihnen im Original zugewiesenen Wert, im Fettdruck präsentiert. Womöglich liegt dem ein Missverständnis Fröhlichs zu Grunde, die im Vorwort schreibt, der (frühere) Sperrdruck habe auf "besonders charakteristische klinische Hinweise" (S. 8) aufmerksam machen wollen, was mitnichten bedeutet, dass alle klinischen (nicht prüfungsbasierte) Symptome besonders charakteristisch seien.B 3) Bacillinum wurde ergänzt
Erwähnt sei noch, dass die Herausgeberin dem Werk ein einziges Arzneimittel hinzugefügt hat - Bacillinum. Warum dieses und nur dieses ergänzt wurde, bleibt offen. Auch die Art der Darstellung will sich nicht so recht in "den Mezger" einfügen. Dass Burnett nicht den Vornamen "Taylor" führte (was auf Seite 637 übrigens nochmals falsch angegeben ist) und der genannte John Henry Clarke falsch (als "Clark") geschrieben ist, ist als Flüchtigkeitsfehler eher nebensächlich. Aber dass sich das Arzneimittelbild aus einer einzigen Quelle bedient, die zudem nicht auf Prüfungsergebnissen basiert - was wiederum zu einer besonderen Kennzeichnung aller Symptome mit einem ʘ hätte führen müssen - das passt nicht in die grundsätzliche Struktur des "Mezger". Auch die in diesem Zusammenhang präsentierte ebenso kryptische wie unkonkrete Auslegung des in der Homöopathie nicht unumstrittenen Begriffs "Miasma" könnte irritieren: "Das Miasma ist eine Zustandsbeschreibung des Individuums, die auf verschiedenen Betrachtungsebenen ähnlich charakteristisch werden kann." (S. 323) Ähnlich spekulative Anmerkungen finden sich, wie zu erahnen, bei Medorrhinum (S.1045-1047), Psorinum (S. 1262f.) Syphilinum (S. 1478). Für den Leser, der keine der Vorauflagen besitzt, ist an dieser Stelle nicht mehr zwischen dem Original Mezgers und der Ansicht der Herausgeberin zu unterscheiden. Künftige Generationen werden diese Äußerungen womöglich als Mezgers Standpunkt wahrnehmen.B 4) Neue Sichtweise ergänzt – ohne Kennzeichnung
Heimlich, still und leise scheint den "Mezger" eine homöopathische Methodik infiltriert zu haben, von der man meines Erachtens nicht sagen kann, dass sie seiner ursprünglichen Intention folgt. Eher scheint hier die homöopathische Ausrichtung der Herausgeberin maßgeblich zu sein. So werden unter den Vergleichsmitteln der jeweiligen Arznei die des entsprechenden Tier- oder Pflanzenreichs bzw. der im Periodensystem nahe stehenden Elemente aufgelistet - was an Jan Scholtens oder Rajan Sankarans nicht unumstrittene Ansichten von Ähnlichkeit erinnert. Auch in Kleinigkeiten sickert diese Sichtweise ein. So ergänzt Fröhlich eine Indikationen bei Angustura um die meines Erachtens fragwürdige Aussage: "Homöopathisch wird Angustura wie andere Baum-Arzneien vor allem bei Beschwerden der Knochen und Gelenke eingesetzt." (Bd.1, S.207) Für den Leser ist nicht erkennbar, dass gerade diese Passage eben nicht bereits im Original stand.Gute Ausstattung
Zu den Äußerlichkeiten: Der "Fröhlich-Mezger" (als "Mezger" mag ich ihn nicht mehr bezeichnen) kommt in sehr guter Druck- und Bindequalität daher. Der Satz ist nun zweispaltig, was man durchaus begrüßen kann. Der Preis ist ebenso stattlich wie das äußere Erscheinen, er mag in dieser handwerklichen Hinsicht durchaus gerechtfertigt sein.Fazit
Es gibt auf dem Buchmarkt der Homöopathie neben unabdingbaren Klassikern auch Werke, auf die man gut und gerne verzichten kann … und letztere Klasse ist durchaus nicht in der Minderheit! Den "Mezger" würde ich gerne zur ersten Gruppe zählen, aber nicht den „Fröhlich-Mezger“ in der vorliegenden Version - die sitzt eher zwischen Baum und Borke.
Es ist leider wenig hilfreich, die fast unmenschliche Arbeit, die hinter einem solchen Projekt der kompletten Überarbeitung steckt, angemessen zu würdigen, wenn gleichzeitig festgestellt werden muss, dass das angestrebte Ziel, nämlich Mezgers Werk "mit Sachverstand und in seinem Sinn ins Heute zu tragen", aus meiner Sicht nicht erreicht wurde. Ich habe, wie gesagt, nur Stichproben untersucht und vielleicht hatte ich einfach Pech (oder Glück) bei der Auswahl. Womöglich aber finden sich bei genauerer Betrachtung weitere Kritikpunkte.
Das Dilemma liegt nun auf der Hand: Im Grunde würde nur rasender Absatz dazu führen, dass man sich in absehbarer Zeit im Hause Haug Gedanken über eine weitere, womöglich erneut verbesserte Auflage machen müsste. Erweist sich das hochpreisige Buch jedoch als Ladenhüter, was zudem bei kritischen Besprechungen eher der Fall sein dürfte, wird man froh sein, wenn die Auflage abverkauft ist und sich hüten, ein solches Risikoprodukt erneut in Angriff zu nehmen.
Zweifellos haben die Herausgeberin und ihre Mitarbeiter einen immensen Aufwand an Arbeits- und Lebenszeit, an Herzblut und Liebe zur Sache geleistet. Umso bedauerlicher, dass das Fazit bei der Beurteilung des Ergebnisses überwiegend negativ ausfallen muss.
Stefan Reis
Hardenbergstr. 2
45472 Mülheim an der Ruhr
Anmerkung: In einer früheren Version dieses Beitrags hatte Stefan Reis geschrieben, Ulrike Fröhlich habe bei Gelsemium einen neuen, informativen Abschnitt "Arzneimittelprüfung" eingefügt, der sich über gut eineinhalb Seiten erstrecke. Diese Angabe war nicht korrekt. Die Bearbeiterin hat darauf aufmerksam gemacht, dass die entsprechende Passage nicht neu eingefügt, sondern im Original bereits vorhanden war und lediglich verschoben wurde.
Bibliografie
Julius Mezger: Gesichtete homöopathische ArzneimittellehreNeu bearbeitet und herausgegeben von Ulrike Fröhlich
13. Auflage, Karl F. Haug Verlag, Stuttgart 2017. 1688 Seiten in 2 Bänden, gebunden. € 199,99
ISBN: 978-3-13-219931-6