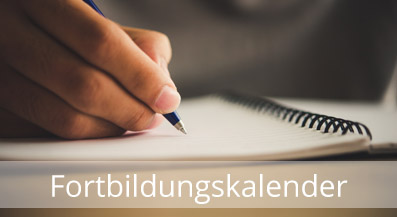Patientinnen und Patienten gibt es nicht
Patientinnen und Patienten gibt es nicht
Die Überwindung der grammatikalischen Leideform und übersehene Türen
„Machst du dich nicht selbst arbeitslos, wenn du mit Homöopathie dann alle geheilt hast?“ – so witzelten einige, als ich 1992 meine erste Praxis eröffnete. Es war eine Zeit hochgesteckter Erwartungen; ich war etwas bescheidener. Heute bleibt dann schon die Frage, wie zumindest einige der vielen Millionen Menschen, denen unser Gesundheitssystem nur eingeschränkt weiterhelfen kann, besser zu uns finden könnten. Neben der Methodik könnte auch unser Selbstverständnis einen Anteil daranhaben. Ich möchte hier weder Mangelgefühle noch Marketingstrategien bearbeiten, sondern Türen öffnen und Perspektiven erweitern. Zu erkunden sind unsere Chancen im Niemandsland zwischen Versorgungsmedizin, esoterischen Märkten und Eigenwirksamkeit. Sollten wir uns Letzterer näher fühlen, besteht die Frage nach Entwicklungsmöglichkeiten auch in der Ansprache von „Patienten“ und „Patientinnen“ – wobei diese Wortprägung schon nicht mehr ganz passt.
Spinatampfer und andere Merkwürdigkeiten der Leideform
Die Homöopathie als Simile-Heilung setzt bekanntlich regulative Impulse und aktiviert Heilkräfte, ohne etwas von außen hinzuzufügen, oder jedenfalls nichts, das eine klassisch pharmakologische Wirkung erwarten ließe. Die Patientin, der Patient selbst ist also der entscheidende Akteur, bewusst oder unbewusst, und nicht etwa ein Passivum. Jedenfalls dann, wenn es auf die Gesundheit zugeht – und so sprechen wir berechtigt von Eigenwirksamkeit. Ist diese gegeben und macht der Mensch den ersten Schritt, dann kann der Kosmos vieles hinzugeben. – Kurz nur zur Linguistik: Patient, Patientin zu sein beinhaltet sprachlich ein Passivum, das als solches einer Eigenwirksamkeit diametral entgegensteht. Das Wort „Patient“ wie auch die grammatische Kategorie des Passivum, auch Leideform genannt, haben die gleiche sprachliche Wurzel: „pati“ (pateo, passus sum) ist leiden, dulden, etwas über sich ergehen lassen. Leiden bedeutet deutsch wie auch lateinisch nicht einfach nur Schmerz. Wenn ich jemandem sage, „ich kann dich gut leiden“, dann kann ich es ja gerade sehr gut aushalten mit diesem Menschen. Ebenso kennen wir die Leidenschaft, die Passion: Eine Emotion ergreift und treibt mich wie auf einer Woge, so dass ich Lust und Schmerzen einfach unterworfen bin.
„Der Patient, die Patientin in der Mitte“ – wollen wir das wirklich? Ich denke hier an schöne Worte wie Patientenschutz, an den unserem Gesundheitssystem zugrunde liegenden Versorgungsgedanken sowie auch an „Gesundheit als Menschenrecht“ auf WHO-Ebene oder schon seit dem UN-Sozialpakt von 1966. Dahinter stecken sinnvolle, aber auch einseitige Überlegungen. Eigenverantwortung wird aberzogen, der Patient, die Patientin als Passivum wird weitestgehend festgeschrieben. Der Staat trifft Festlegungen, wie er das Menschenrecht auf Gesundheit schützen will, so etwa durch Immunisierungspflichten. Freie Therapiewahl bleibt als Spielwiese der Begüterten und auch das eher nur als Add-On, unsere Integrativmedizin agiert da manchmal etwas vorauseilend. Das ist ja kein nur von außen kommendes System. Die dahinterstehenden Denkweisen und Gewohnheiten können wir ungeachtet der medizinischen Ausrichtung genauso in uns selbst auffinden. – Kleine Glosse: Bei Hahnemann, der fließend Latein sprach, findet sich die Zeichenfolge <patient*> mit digitaler Suche im Organon – dort nur einmal in der Einführung – dann in RAL, CK und einigen frühen Schriften lediglich vier Mal, mitgerechnet den Eintrag in seinem Apothekerlexikon (1793- 1799) für Spinatampfer, „Rumex Patientia“. Damals sprach man allgemein eher von „Kranken“.
„Alles Leben ist Leid“, so der vielleicht bekannteste überlieferte Ausspruch des Gautama Buddha vor 2.500 Jahren. Buddha behauptete nie, dass alles Leben eine Qual sei. Es war die nüchterne Bestandsanalyse des allgemeinen geistigen Schlafzustandes der Menschheit, in dem Schmerz und Lust, Kummer und Freude schicksalhaft erfahren werden, wie in einem Räderwerk und wie in einem Traum, der nur scheinbar selbst gesteuert wird. Wir glauben zwar, Entscheidungen zu treffen und Dinge zu bewirken. Aber bei ehrlicher Betrachtung folgt fast alles unseren Trieben und Ängsten, unseren Konditionierungen und Gewohnheiten, inneren Notwendigkeiten und äußeren Gegebenheiten. Ganz mit Buddha könnten, ja müssten wir sagen „Wir alle sind Patienten“. Wir alle leiden, manchmal nur im einen, oft auch im anderen Sinne des Wortes. – Vielleicht aber wäre, so nach 25 Jahrhunderten, auch Buddha einmal neu zu befragen? Die Menschheit hat sich fortentwickelt. Im positiven wie auch im negativen Sinne, soweit man es werten möchte. Verändert hat sich vor allem eines: Ein fortdauernder Schlaf von Geist und Seele ist heute richtig gefährlich! Selbstverständlich steht jeder Mensch in seiner Entwicklung woanders, dafür ist genügend Platz. Gefährlich aber ist jeder Stillstand, jede Nicht-Entwicklung. Aber auch der Topos des Erwachens wird leichtfertig bedient, sei dies durch vermeintliche Lösungsanbieter, mit dem Wort/Schimpfwort „woke“ oder wenn Menschen von einer Seite groß angelegter Manipulation in eine andere, scheinbar entgegengesetzte Form kollektiver Manipulation und Selbsthypnose hineinrutschen. Ein Freund formulierte es in der Corona-Zeit einmal so: „Schlafende rufen einander zu: Erwachet!“. Es gibt so viele Hypnosetherapien (gr. hypnossein = schläfrig sein) und manche scheinen gut zu sein. Vielleicht sollten wir heute aber sehr viel mehr enthypnotisieren, in alles Träumende und Schlafende in uns eintauchen und auch in diesen Bereichen aufräumen und wach werden.
Leben und gelebt werden, ein Spannungsbogen
Das große, weite Feld der Wirklichkeit ließe sich demnach beschreiben als ein Spannungsbogen zwischen „Es gibt keine Patienten“ und „Wir alle sind Patienten“. Das stimmt nicht nur trivial, indem wir alle auf einer gewissen Skala zwischen gesund und krank unterwegs sind. Für unseren Kontext interessant bleibt das Feld zwischen „werde ich gelebt“ oder „lebe ich tatsächlich“, mithin die Überwindung der vielleicht nicht nur grammatikalischen Leideform. „Lebe“ ich als Therapeutin oder Therapeut, bedeutet: bin ich geistig-lebendig präsent, dann kann es eher gelingen, Lebensgeist und Lebenssinn im Hilfe suchenden Gegenüber anzusprechen, einfach indem ich in Resonanz gehe. Oft geht das nur in kleiner Dosis. Es ist aber etwas grundsätzlich Anderes als bemühte Ermutigung. – Nicht verkennen möchte ich, dass Leidende in den meisten Fällen in beiderlei Sinne leiden, durch die Beschwerden an sich sowie auch als dem Geschehen Unterworfene. Eine schwere Erkrankung kann alles, was das bisherige Leben ausmachte, massiv erschüttern. Das ist seelisch wie auch in den praktischen Konsequenzen zu verkraften. Hinzu kommen oft Schwäche, körperliche Einschränkungen und anhaltende Schmerzen. Oft sind wir ja stark mit unseren aktiven Rollen im Leben identifiziert – wer aber sind wir, wenn diese teilweise oder ganz wegfallen? Manche Menschen wiederum fliehen angesichts einer schweren Diagnose in Aktionismus, manchmal im Wechsel mit Depression. Was helfen die Rechte auf gesundheitliche Selbstbestimmung und „informierte Entscheidungen“, wenn ein Mensch jeden Kontakt zu sich selbst verloren hat und nicht in der Lage ist, aus einer relativ ruhigen inneren Mitte heraus zu einer Selbstwirksamkeit zu gelangen? Diese kann auch die Akzeptanz des nach menschlichem Ermessen Unvermeidlichen einschließen. „Passivierend“ wirken schließlich auch unser aller Prägungen durch den Versorgungsgedanken als Grundlage der staatlich regulierten Gesundheitssysteme. Eigenwirksamkeit oder ein jedem Menschen innewohnendes Wirkprinzip (Agens) scheinen da erstmal recht fern. Wiederum von anderer Seite wird „Heilung von innen“ zu einem esoterischen Produkt gestylt, das höhere Welten imitiert und dann womöglich mehr als alles andere im Wege steht.
Freiheit des Geistes, das geheime Agens und Entwicklung
Kennen wir nicht alle die kleinen Wunder, dass ein Mensch, nach einem guten Simile und mit den ersten sonstigen Zeichen einer Gesundung einhergehend, ganz von selbst wieder initiativer wird, ein anderes Verhältnis zu sich selbst gewinnt, ein wenig anders im Leben steht, ganz ohne äußeres Wollen oder Anstrengung? Nicht immer zeigt sich das so auffällig. Manchmal laufen die Prozesse eher untergründig oder verwischen sich mit psychotherapeutischen Effekten. Aber schon der Meister beobachtete, ihr kennt § 253 Organon: „Im Falle des auch noch so kleinen Anfanges von Besserung – eine größere Behaglichkeit, eine zunehmende Gelassenheit, Freiheit des Geistes, erhöhter Muth, eine Art wiederkehrender Natürlichkeit“. So lesen wir, sei dies „vorzüglich in den schnell entstandenen (acuten) Krankheiten“. Auf chronischem Terrain verlaufen die Heilungsprozesse oft komplexer und weniger geradlinig, im Grundsatz gilt aber das Gleiche. „Freiheit des Geistes“, ganz ähnlich klingt das doch schon in § 9 Organon, dort als Charakteristikum der Gesundheit. Oder ist der freie Geist zugleich ein heimliches Agens, ein verstecktes Wirkprinzip der Gesundung? So direkt sagt Hahnemann das nicht, spirituell-psychologische Fragen sind kaum sein Thema. Und mit der Freiheit ist‘s ja nicht so einfach – wer oder was in uns ist überhaupt frei? Frei von Gier, Angst und Hass, frei von Verstrickung, Sucht und Verblendung, frei überhaupt von Illusionen? So fühlte man lange Zeit vor allem im Osten. Aus dem Westen kommt hinzu, klingt auch bei Hahnemann mit: Frei wozu – was ist der Sinn und was ist dann freie Tat? Ich erörtere lediglich, was Freiheit bedeutet, falls wir tatsächlich frei sein wollen. Solche Fragen bewegte auch mein Beitrag beim SiMILE-Kongress 2025 zu einer individuali-sierenden „Ethik der Freiheit“.
Trivial ist Freiheit wohl nicht zu haben und kann nur eine Richtungsangabe sein. Gestattet mir einen Einschub, ein scheinbares Nebenthema, denn eine Spur muss ich zuerst legen, einen Ausgangspunkt gewinnen, der dann die Perspektiven erweitert. Denn als Voraussetzung rechne ich die Betrachtung, dass wir Menschen Entwicklungswesen sind. Damit meine ich nicht zuerst die leibschaffende biologische Evolution (eigentlich eine Involution des Kosmos), sondern die großen Bögen der Biografien, auch über einzelne Lebensspannen hinausgedacht, sowie auch von fernster Menschheits-Herkunft hin zu Menschheitszielen. Das sind keine Glaubensgegenstände, erforsche es jede, jeder selbst. Freiheit und Gesundheit erscheinen dabei merkwürdig verschränkt zu sein miteinander, nicht in einer linearen Beziehung, aber eben in solchen Entwicklungszusammenhängen. Neben eigenen Themen nehmen wir dabei solche aus unserem Umfeld in die Alchemie der Wandlung. Freiheit in vollem Sinne, wenn wir sie wollen, muss erst noch geboren werden. Auf dem Wege liegen Erkrankungen, Heilung und unser Auftrag in der Welt. Was in der Heilung eigentlich wirkt, kommt aber gewissermaßen vom anderen Ende her, nicht etwa aus Schicksal und Verstrickung, auch Karma genannt, nicht aus der Vergangenheit, sondern von dort her, wo wir noch gar nicht sind, wenn nicht aus der allerweitesten Zukunft: vom Freiheits-Pol. Diese Zukunft jenseits der Zeit – auch Ursprung unserer selbst, mit Blick in ferne Vergangenheiten würde ich hier allerdings nicht von Freiheit sprechen – ist zugleich gesteigerte Gegenwart, ist ein im Bewusstsein aufleuchtendes Licht, ein Gewahren des Bewusstseins selbst jenseits der Identifikationen und Selbst- Erzählungen. Das überhaupt einmal zu erfassen und zu erfahren ist, wie jede echte Erkenntnis- Erfahrung, schon viel und bei weitem nicht jedem zugänglich. Und selbst wenn dieses Licht gelegentlich angeknipst ist, erfasst und durchdringt es noch nicht die Lebenskräfte – von denen her Heilung wirkt – oder gar den Leib bis in den Tanz der Moleküle. Daher sage ich: Wo Heilung geschieht, wirkt „etwas“ aus der weitesten Zukunft in die Gegenwart hinein. Was aus bloßer Vergangenheit fortwirkt, das gibt uns Grund und Boden, verbraucht sich aber und erneuert sich nicht aus eigenen Kräften. Und wer oder was in uns ist gleichermaßen erster Ursprung, Gegenwart und fernstes Werdeziel? Mit dieser Frage rühren wir an die Frage der Essenz unseres Wesens, nach jenem Wesenskern oder Kernwesen, das alles und zugleich nichts von alledem ist. Für dieses Wesen sind unsere Organe und Lebenskräfte, Emotionen und selbst unsere seelischen Landschaften in ähnlicher Weise Außenwelt wie Haus, Garten und sonstige Mitwelt. Dieses ist der alten Sprache nach der Heiland, nicht eine historische Person, sondern der Heiler der Lande im Innern und dann rundum. Dort ist die Wurzel des Ichs, das „Ich Bin Ich“ (Sanskrit „So-Ham“) jenseits Trennung, Wahn und Eigensucht, eins mit allem und doch „Ich“. Begriffe wie Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit sind Brücken dahin. Brücken, die beschritten werden dürfen.
Eigenverantwortung und die Freiräume im therapeutischen Dreieck
Ich sagte: Im Heilungsprozess ist der Patient nicht mehr nur Patient, im Titel spitzte ich zu: In der Gesundung gibt es keine Patientinnen und Patienten. Im heutigen Bewusstseinsgefüge der Menschen laufen solche Prozesse überwiegend unbewusst ab, dann sollten wir ihnen zumindest nicht entgegenstehen. Ebenso gilt das Gegenteil: Eingebunden in den allgemeinen Lebensumständen sind wir heute alle „homines patientes“, dem Geschehen Unterworfene. Diese beiden Wirklichkeiten gilt es gleichzeitig zu erblicken. Das ist ein schöpferisches Spannungsfeld, das wir nutzen könnten – und zwar mit weit größeren Freiräumen als die Akteure der staatlich organisierten Gesundheitsversorgung. Die können das genau nicht, weil der staatliche Auftrag eben die Versorgung und damit die Passivität der Kranken ist. Unser Auftrag, oder besser unsere Chance wäre demnach, Kranke dahingehend zu begleiten, dass sie in ihren Lebenskräften, aber auch in ihrem Wesen von innen her wieder initiativ und aktiv werden. Beide Seiten tragen dabei ihre jeweils eigene Verantwortung. Für uns zu erforschen bleibt, was dies für das eigene therapeutische Selbstverständnis, für unsere Rollen und für Gespräche bedeutet – mit der Bereitschaft, unsere Therapie insgesamt genauso zu individualisieren wie die Wahl des Simile.
Die rechte Wahl und Gabe des Simile steht für das homöopathische Prinzip an erster Stelle. Simile sind Tür-Öffner. Das heilende Prinzip ist selbst Gesundheit und ist nicht identisch mit den Lebenskräften, aber nahe an deren Steuerung. Die Lebenskräfte werden ja nur reguliert und nicht zugefügt. Die Globuli oder Tropfen dienen als Anstoß- Geber und Vermittler, nicht mehr und nicht weniger. Doch eigentlich steht jede gute Therapie, manchmal wird das übersehen, auf drei gleich wichtigen Pfeilern: Therapeut/in, Methode und Patient/in. Wacklig wird’s, wenn der Stuhl nur ein oder zwei Beine hat. Drei Punkte sind in der Fläche das Minimum, um einen Innenraum aufzuspannen. Auch der Umraum des Geschehens ist mit in Betracht zu ziehen, wie beispielsweise die Lebens- und Arbeitssituation des Kranken, anstehende Veränderungen oder unsere Praxisführung. Mehr als dies aber brauchen Heilungsprozesse innere Räume: im beschriebenen therapeutischen Dreieck von Methode, Behandler/in und Patient/in, im Heilung suchenden Gegenüber, in uns selbst, um alledem nicht im Wege zu stehen, und schließlich auch in den homöopathischen Potenzen, aus denen das Stoffliche der Wirksubstanzen ja sozusagen herausgerieben oder geschüttelt wurde. Diese Art von Innenraum ist wesentlich, denn wie soll „Neues“ in die Welt kommen und auch Heilung geschehen, wenn wir keine nicht vordefinierten Räume zulassen und alles aus dem Alten vorherbestimmen?
Ungeteilte Aufmerksamkeit, Türöffner und unsere Chancen
Was aber bedeutet dies für die Praxis? Wie können wir für Hilfe suchende Menschen neue Türen öffnen? Durch das, was sie bei uns erleben. Es gibt keine kurzen Wege, ohne eigene innere Prozesse und ohne gewohnte Rahmen zu überschreiten. Ich bin ja nicht der Erste, der es sagt: Aus einem trockenen Brunnen kommt kein Wasser. Was wir uns wirklich errungen haben, geht in unser Sein und unsere Haltung über. Weitere Türen öffnen sich dann auch unerwartet. Widerstände wird es ebenso geben, in uns selbst, durch uns umgebende Systemmechaniken oder auch durch das Umfeld einer, verzeiht mir die Ausdrucksweise, vom Marketingdenken versauten Pseudoesoterik. Ein bunter Strauß von Methoden, Online-Events und mitreißenden „Speakern“ ersetzt nicht, was leise in uns wachsen will und zur rechten Zeit von selbst Frucht trägt.
Einen unmittelbar anwendbaren Tipp gebe ich doch, und der betrifft die Vorbereitung auf die Menschen, die wir gesundheitlich und vor allem auch bei chronischen Leiden begleiten. Das eine ist der Blick in die Akten, in die letzten Notizen. Schon seit den ersten Jahren meiner Praxistätigkeit machte ich immer ein Zusammenfassungsblatt, nicht nur Repertorisationen, sondern ein Übersichtsblatt zu allem Relevanten. Zum anderen – und das machte ich mir erst in den letzten Jahren zur Gewohnheit – gebe ich mir den Raum, auch mit einem Moment der Stille, eine zunächst innere Verbindung zu diesem Menschen aufzunehmen und in diesem inneren Raum möglichst offen zu sein für das, was sich zeigt und was es braucht. Tatsächlich verändern die Gespräche sich dadurch. Nicht nur, dass ich präziser auf Verlaufsparameter komme, wie Veränderungen von Hauptbeschwerde, Gemüt und Allgemeinbefinden und so fort. Durch mentale Vorbereitung und entspannt gesammelte Aufmerksamkeit bleiben die Gespräche beim Wesentlichen auch dann, wenn sogenannte Nebenthemen aufkommen. Brutto spare ich so Zeit oder nutze diese besser.
Nebenthemen sind manchmal Türöffner oder zeigen sich, solange wir dem Kern des Geschehens auf der Spur sind, als therapeutisch bedeutsam. Manchmal liefern sie Nebensymptome oder sie helfen, die Hauptbeschwerde zu kontextualisieren. Oder es öffnen sich Türen zu jenem Kern und Agens der Eigenwirksamkeit, von dem wir sprachen. Ob und in welcher Weise, wie bewusst und in welchem Grade das möglich ist, das liegt natürlich auch am Gegenüber. Fast körperlich spürbar sein können Momente größerer Präsenz oder besserer Verbundenheit. Hilfreich ist absichtslose, aber ungeteilte Aufmerksamkeit, ebenso eine Haltung des gemeinsamen Entdeckens eher denn als Ratgeber, Augenhöhe ohnehin. Wir kennen auch die Balance zwischen Nähe und Abstand, denn zu viel Nähe überlagert die Prozesse mit unserem eigenen Schwingungsfeld, anstatt im therapeutischen Dreieck einfach dem Raum zu geben, was geschehen will. Abzuspüren und gelegentlich zu klären bleibt freilich auch der Auftrag der Patientin, des Patienten, um diese vorläufig noch einmal so zu nennen. Nie sollten wir hineinschlittern in etwas, das wir nicht vorab angeboten haben und auch nicht danach gefragt wurden. Etwas Handwerk dazu, etwa mit einfachen körperlichen Untersuchungen und medizinische Beratung bilden einen weiteren Pol unserer Kompetenz, der dritte oder vielmehr erste ist natürlich die Homöopathie. – Ich selbst erlebe meine Arbeit mit solchen erweiterten Perspektiven interessanter und befriedigender. Die Kranken und Hilfesuchenden erfahren nicht nur eine andere Therapiemethode, sondern ein grundsätzlich anderes Herangehen, das unsere Versorgungsmedizin inklusive Psychotherapie nicht liefert. Ich meine, wir haben die Chance, unser therapeutisches Selbstverständnis, das Angebot und damit auch die Nachfrage weiterzuentwickeln, wenn wir die Homöopathie nicht nur als Methode profilieren, sondern sie erkennbar in einen Kontext einbetten, den weder öffentliche Gesundheitsversorgung noch ein esoterischer Jahrmarkt bereitstellen.
Carl Classen
(VKHD-Vorstand)